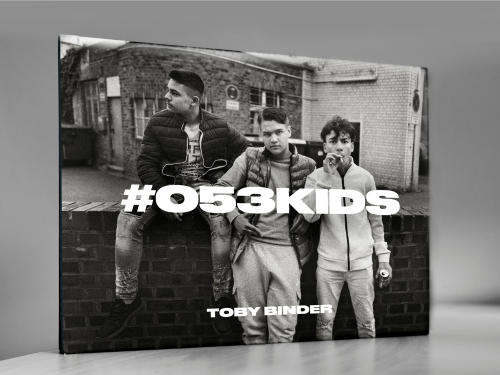"Es ist nicht der Sport, der Werte vermittelt, es sind die Personen"
Demokratiepädagogik auf dem Platz
2.10.2024
Die ersten braunen Blätter wehen über den Rasen, trotzdem verspricht es heute noch mal ein spätsommerliches Fußballtraining zu werden. Die Jugendlichen trudeln nach und nach ein, stehen zusammen und quatschen noch ein bisschen – über den Schultag, die nächste Matheklausur und über die Pläne fürs Wochenende. Da kommt der Trainer um die Ecke, motiviert und gut gelaunt wie fast immer. „Tach zusammen! So Leute, heute konzentrieren wir uns mal auf das Thema Doppelpass und machen ein paar Stellungsübungen dazu. Los geht’s, aufwärmen!“ Dass in dem Moment zwei Personen in der Mannschaft denselben Gedanken haben, erfährt niemand: „Mist, heute wäre Kopfballtraining echt wichtig gewesen, da hatten wir im letzten Spiel einige Probleme. Hat er das nicht auf dem Schirm?“
Dass keiner der beiden den Mut hat danach zu fragen oder erst gar nicht in Erwägung zieht, dass der Gedanke wertvoll für das ganze Team sein könnte, hängt vermutlich damit zusammen, dass das Thema Partizipation, also Mitgestaltung, in vielen Trainingsformen gar nicht stattfindet. Dabei lässt sich im Sport und speziell im Fußball viel mehr vermitteln als die reine Technik: Welches große Potenzial zur Persönlichkeitsentwicklung im Fußballtraining liegt, zeigt das Projekt "TeamKickers – Fußball lebt Demokratie" der Zukunftsstiftung Bildung. Hier erfahren Kinder und Jugendliche eine neue Art des Fußballtrainings, das neben sportlichen Fähigkeiten auf die Entwicklung demokratischer und sozialer Kompetenzen abzielt.
"Der Umgang mit Unterschieden ist eine wesentliche Herausforderung im Sport"
„Die Bedingungen sind günstig, dass sich diese Potenziale auch ausschöpfen lassen. Kinder und Jugendliche sind mit Begeisterung bei der Sache. Sie erleben und gestalten aktiv die Herausforderungen des Miteinanders und Gegeneinanders. Der Umgang mit Unterschieden und mit teils gegenläufigen Interessen ist eine wesentliche Herausforderung im Sport. Wichtig dabei: Nur wenn im Training auch zu Selbst- und Mitbestimmung aktiv aufgefordert wird, kann sich die Förderung der Demokratiefähigkeit auch ergeben,“, sagt Sportpädagoge Prof. Dr. Christian Gaum. Er leitet den Lehr- und Forschungsbereich Sportpädagogik an der Ruhr-Universität Bochum und unterstützt das Projekt TeamKickers, das von der DFL Stiftung als Hauptförderer finanziert wird.
Selbstwirksamkeit, Partizipation, Verantwortungsübernahme, Empathie sowie Konflikt- und Kommunikationsfähigkeit sind demokratische Handlungsfähigkeiten, die die Teilnehmer*innen im Projekt neben demokratischen Werten und Prinzipien durch Erproben entwickeln können. Jugendliche Fußballer*innen im Alter von 14 bis 18 Jahren durchlaufen ein Trainingsprogramm, das sie sportlich und persönlich fördert und dazu befähigt, ihre Erfahrungen im Sinne des Peer-Learnings selbst als TeamCoach mit Kindern und Jugendlichen aus ihrem Verein zu teilen. In ihrer Rolle als TeamCoach gestalten sie dann mit beratender Unterstützung selbstständig Trainingseinheiten und lernen eine neue verantwortungsvolle Perspektive kennen.
Demokratiepädagogik ist ein Konzept, das darauf abzielt, demokratische Werte und Kompetenzen durch praktische Erfahrungen zu fördern. Nach Jon Dewey, dem Begründer dieses pädagogischen Ansatzes, wird Demokratie nicht nur als Herrschaftsform, sondern als eine soziale Idee verstanden – eine Form des Zusammenlebens, in der Menschen gemeinsam und aktiv an ihrer Lebenswelt teilnehmen. Diese Perspektive ist zentral für die Bildung und Erziehung von Kindern und Jugendlichen. Betrachtet man den Vereinsfußball als gesellschaftlich-kulturelles Phänomen aus dieser Perspektive, eröffnet dieser nicht nur einen Erfahrungsraum für sportliche, sondern auch soziale und demokratische Lernprozesse.
Insbesondere der Kinder- und Jugendfußball, der von einer breiten freiwilligen Beteiligung, einer engen Verbindung zur lokalen Gemeinschaft und starkem Zusammenhalt geprägt ist, bietet eine einzigartige Chance bietet, demokratische Werte und Kompetenzen zu fördern und zu stärken. Während der sportliche Erfolg oft im Vordergrund steht, steckt im Mannschaftssport Fußball ein enormes Potenzial für die Vermittlung demokratischer Prinzipien wie Respekt, Verantwortungsübernahme und Mitbestimmung. Der Fußball schafft durch seine Teamorientierung notwendige Interaktionen, die demokratische Prozesse auf ganz natürlichem Wege erlebbar machen. Diese sozialen Interaktionen, wie gemeinsam Entscheidungen zu treffen, Verantwortung zu übernehmen und Konflikte zu lösen, machen den Sport zu einem geeigneten Lernort für Demokratie. Viele dieser Prozesse geschehen unbewusst und es ist wichtig, dass diese bewusst gemacht und gezielt gefördert werden.
Verknüpfung sportlicher und sozialer Lernprozesse
Es ist die Aufgabe der Trainer*innen dieses Potenzial bewusst zu nutzen, indem sie ihr Training entsprechend gestalten und ihre Spieler*innen aktiv mit einbinden. Dazu zählt das Einholen von Feedback, die Einbindung der Spieler*innen in die Trainingsgestaltung, die Übergabe von Verantwortung beispielsweise bei der Durchführung von Trainingsphasen, oder das Einbauen kooperativer Übungsformen. Durch kontinuierliches Reflektieren dieser Erfahrungen, erleben die Kinder und Jugendlichen ein Gefühl von Selbstwirksamkeit und entwickeln ihre Entscheidungs- und Handlungsfähigkeiten weiter. Diese Verknüpfung sportlicher und sozialer Lernprozesse fördert nachhaltig demokratische, soziale und personale Kompetenzen im Fußball, die weit über das Spielfeld hinaus wirken.
Das Aufwärmen ist mittlerweile beendet und die Jugendlichen stellen sich für eine Übung zum Doppelpass auf. Das erste Team legt los und kurz darauf ruft einer von ihnen: „Alter, was ist das für ein Pass? Bist du behindert oder was?“ Der Trainer hat dafür ein kurzes Augenverdrehen übrig, bevor er sich einschaltet: „Nochmal! Der Pass war nix.“ Das Wort „behindert“, das hier völlig unangemessen als Beleidigung benutzt wurde, bleibt stehen. Eine verpasste Chance für Trainer und Mannschaft…
Prof. Dr. Christian Gaum: „Als Jugendtrainer*in muss ich mir immer wieder klar werden, dass ich für die Jugendlichen eine relevante Bezugsperson – ein Vorbild – bin. Mein Reden und Handeln hat Wirkung. Es ist nämlich nicht der Sport, der irgendwelche Werte vermittelt, sondern es sind die Personen, die im Sport agieren. Ich empfehle immer mal wieder etwas innezuhalten und sich zu fragen: Was mache ich da eigentlich? Wie gehe ich mit meiner Trainingsgruppe um? Was will ich? Was wünschen sich die Jugendlichen? Dafür muss man im nächsten Schritt zuhören, aufmerksam sein und auch mal ernsthaft nachfragen. Darüber hinaus ist es besonders wichtig, dass kein Bruch zwischen Reden und Handeln entsteht. Es nützt nichts, wenn Fairness, Respekt und Toleranz gepredigt werden, aber kein respektvoller Umgang mit den anderen Vereinsmitgliedern, Gastmannschaften oder den Schiedsrichter*innen gepflegt wird. Es gehört auch dazu klare Kante bei Fehlverhalten zu zeigen und für etwas einzustehen. Wenn zum Beispiel rassistische oder sexistische Äußerungen fallen, dann muss das angesprochen und Position bezogen werden. Ich höre oft so Sätze wie ,Im Sport ist das halt so, bei uns geht’s auch mal härter zur Sache und da fallen auch mal derbere Sätze...‘ Meine Antwort: So muss es aber nicht sein!“
Als Vorbild tragen Trainer*innen eine soziale und gesellschaftliche Verantwortung
Trainer*innen, insbesondere im Kinder- und Jugendfußball, sind nicht nur Expert*innen für Fußball, sie sind Vorbilder. Als Vorbild tragen sie eine soziale und gesellschaftliche Verantwortung. Fußball ist ein beliebter und auf der ganzen Welt verbreiteter Sport, bei dem Menschen unterschiedlichen Geschlechts, Alters, ethnischer Herkunft und sozialem Hintergrund aufeinandertreffen. Als Wettkampfsport ist er geprägt von Erfolg und Misserfolg und löst viele Emotionen in Trainer*innen und Spieler*innen aus. Dadurch entsteht auch ein hohes Konfliktpotenzial, das einerseits eine Herausforderung, andererseits aber auch eine Chance darstellt. Im Umgang mit sprachlichen und zwischenmenschlichen Konflikten müssen Trainer*innen sensibel agieren und aktiv intervenieren. Auf unangemessenes oder diskriminierendes Verhalten muss konsequent reagiert werden. Um demokratische Werte wie Fairness, Respekt, Akzeptanz und Gleichberechtigung zu vermitteln, müssen diese auch in der Praxis gelebt werden. Der*die Trainer*in ist in der Vorbildfunktion dafür verantwortlich diese Werte und Prinzipien vorzuleben und zu verkörpern. Die Einhaltung von Regeln, die Integration sozialer Normen in den Fußball und der Umgang mit Konflikten werden durch das Auftreten, die Sprache und das Handeln des*der Trainer*in geprägt. Konfliktsituationen stellen gute Möglichkeiten für Kinder und Jugendliche dar zwischenmenschliches Handeln und Verhalten zu erproben und so Konfliktlösungskompetenzen wie das Aushandeln von Kompromissen, Kommunikationsfähigkeiten und Empathie zu entwickeln.
Ein weiterer Aspekt, der aus dem Beispiel hervorgeht, ist der Umgang mit Fehlern. Fußball ist eine Sportart, bei der sowohl die Häufigkeit als auch die Art der gemachten Fehler oft über Erfolg oder Misserfolg entscheidet. Kinder und Jugendliche sind dadurch häufig mit Rückschlägen konfrontiert. Gutes Coaching und die Etablierung einer Fehlertoleranz können den Spieler*innen helfen aus diesen Situationen zu lernen, anstatt sie als negative Erfahrungen wahrzunehmen. Ein Augenverdrehen als non-verbaler Kommentar hinterlässt ein diffuses defizitäres Gefühl im Team und gehört sicher nicht zum Mittel der Wahl auf Trainer*innenseite. Fehler sollten dementsprechend nicht einfach als Misserfolge dargestellt werden, sondern vielmehr als Lerngelegenheiten aus denen wertvolle Erfahrungen gewonnen werden können. Indem Fehler als Teil des Lernprozesses akzeptiert werden, wird eine positive Fehlerkultur gefördert, die das Wachstum und die Weiterentwicklung der Spieler*innen unterstützt.
Das Projekt "Teamkickers – Fußball lebt Demokratie" ist als Pilotprojekt im September 2024 gestartet und richtet sich zunächst an Fußballvereine mit Jugendmannschaften im Kreis Bochum. Eine Region, in der Vereins- und Freizeitsport einen großen Stellenwert hat, wie Prof. Gaum erklärt: „Abseits der konkreten Zahlen ist der Stellenwert des Freizeit- und Vereinssports im Ruhrpott historisch gewachsen und immer noch von großer Bedeutung. Die Verbundenheit zu Vereinskultur – speziell im Fußball – ist schon etwas Besonderes. Die Fülle an großen Vereinsnamen mit langer Tradition ist immens und im Pott treffen Menschen unterschiedlicher Herkunft aufeinander. Wir haben also eine große Vielfalt und genau damit recht spannende Bedingungen für Demokratiebildung im Sport.“
Der Fußball wird oft als Spiegelbild unserer pluralistischen Gesellschaft bezeichnet – er bringt Menschen unterschiedlicher sozialer und kultureller Herkunft zusammen und weist im Vereinsleben ähnliche Strukturen und Herausforderungen auf. Als sozialer Knotenpunkt eignet sich der Kinder- und Jugendfußball daher hervorragend als non-formaler Lernort für soziales und demokratisches Lernen. Demokratische Werte und Prinzipien wie Respekt, Akzeptanz und Solidarität werden hier auf spielerische Weise erfahrbar. Dadurch bietet der Fußball eine ideale Plattform, um gezielt Kompetenzen zu fördern, die für die Persönlichkeitsentwicklung junger Menschen hin zu mündigen und sich ihrer Verantwortung bewussten Bürger*innen zentral sind. Spielerinnen lernen, Entscheidungen zu treffen, Konflikte zu bewältigen und Verantwortung zu übernehmen – Fähigkeiten, die nicht nur auf dem Spielfeld, sondern auch im Alltag von Bedeutung sind.
Trainer*innen können den sozialen Raum Fußball zu einem Lernraum entwickeln
Die Rolle des*der Trainers*in spielt in diesem Prozess eine besonders wichtige Rolle. Trainer*innen sind eben nicht nur Trainer*innen für fußballerische Fähigkeiten, sondern auch Coaches und Vorbilder für soziales und zwischenmenschliches Verhalten. Ihr Handeln und ihre Worte prägen das soziale Klima innerhalb einer Mannschaft und damit auch jede*n Spieler*in individuell. Indem sie einen respektvollen Umgang pflegen und auf diskriminierendes Verhalten aktiv reagieren, setzen sie ein wichtiges Zeichen für die Jugendlichen. Sie sind es, die den sozialen Raum Fußball zu einem Erfahrungs- und Lernraum entwickeln können, in dem sie demokratische Prinzipien wie Selbstwirksamkeit, Mitbestimmung und Toleranz gezielt praktisch erfahrbar machen. Ihre Vorbildfunktion spielt eine zentrale Bedeutung für das soziale Lernen und die Entwicklung demokratischer Kompetenzen im Fußball.
Im Rahmen des Projekts "Teamkickers – Fußball lebt Demokratie" werden genau diese Aspekte gezielt gefördert. Die Teilnehmenden erleben Mitbestimmung und -gestaltung in den Trainingseinheiten, und entwickeln ein Bewusstsein für zwischenmenschliche und demokratische Werte und Prinzipien. Sie übernehmen Verantwortung, erfahren Selbstwirksamkeit und lernen, Entscheidungen zu treffen, indem sie selbst zu Coaches für Jüngere werden. Das Projekt schafft einen Erfahrungsraum, in dem Kinder und Jugendliche sich sowohl sportlich als auch persönlich weiterbilden und somit als mündige und verantwortungsbewusste Bürger*innen heranwachsen können.
Text: Robert Tigges, Verena Waldhoff